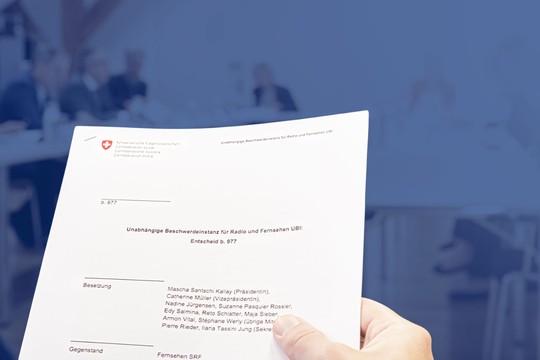Die Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts beschäftigt die Stimmbevölkerung

Mehrere Beanstandende kritisierten die SRF-Berichterstattung über die Abstimmungsvorlage betreffend Abschaffung des Eigenmietwerts. In zwei Beanstandungen von «Tagesschau»-Beiträgen geht es um den Begriff «fiktives Einkommen» bzw. um einen Vergleich von Kampagnenbudgets mit Kostenargumenten.
In mehreren Beanstandungen geht es um spezifische Detailfragen. Exemplarisch werden in diesem Artikel zwei Beanstandungen zu drei «Tagesschau»-Beiträgen vorgestellt. Links zu den restlichen Beanstandungen zum Thema finden sich am Schluss des Artikels.
Darum geht es in den beanstandeten Sendungen
Am 28. September 2025 stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung indirekt über die Abschaffung des sogenannten «Eigenmietwerts» ab. Die «Tagesschau» vom 12. Juli 2025 informierte darüber, dass sich aus einem Teil der Wirtschaft beziehungsweise der Baubranche Widerstand gegen die Abstimmungsvorlage regt.
Im beanstandeten «Tagesschau»-Beitrag vom 18. Juli 2025 liegt der Fokus auf dem Namen der Abstimmungsvorlage, bei deren Annahme der Eigenmietwert abgeschafft werden soll. Im Namen der Vorlage «Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften» ist der Begriff «Eigenmietwert» nicht enthalten. Dies stellt eine Herausforderung für die Abstimmungskomitees dar. Im Beitrag werden die Abstimmungskomitees dazu befragt.
Die «Tagesschau» vom 22. August 2025 stellt eine Meinungsumfrage des GFS Bern zur Abstimmungsvorlage ins Zentrum. Die Resultate der Umfrage werden präsentiert und von einer Politikwissenschaftlerin des GFS eingeordnet. Darauf kommt je eine Vertretung der Befürworter und der Gegner der Abstimmungsvorlage zu Wort.
«Tagesschau» vom 12. Juli 2025:
«Tagesschau» vom 12. Juli 2025:
«Tagesschau» vom 18. Juli 2025
«Tagesschau» vom 22. August 2025
Was wird beanstandet?
Der Beanstander von Ombudsfall Nr. 11649 kritisiert in der «Tagesschau» vom 12. und 18. Juli 2025 die Bezeichnung «fiktives Einkommen» zur Berechnung des Eigenmietwerts. Fiktiv bedeute «frei erfunden». Im Zusammenhang mit dem Eigenmietwert sei die Bezeichnung «fiktiv» jedoch klar falsch und irreführend, moniert der Beanstander. Es werde mit dem Ausdruck emotional auf das Publikum eingewirkt.
Denn der Eigenmietwert sei nicht fiktiv, sondern lediglich nicht sichtbar, da Eigentümer (Vermieter) und Nutzniesser (Mieter) dieselbe Personen seien, erklärt der Beanstander. Indem Eigenheimbenutzer ihr Haus selber nutzten, fliesse ihnen rein wirtschaftlich betrachtet ein Nutzwert zu. Dieser Naturalertrag stelle ein Einkommen dar wie Mietzinseinnahmen bei einer Vermietung einer Liegenschaft bzw. Wohnung.
Die «Tagesschau» vom 22. August 2025 verglich das Kampagnenbudget des Ja-Lagers mit dem Kostenargument des Nein-Lagers. Es würde gesagt, das Ja-Lager könne sieben Millionen Franken Kampagnenbudget in die Waagschale werfen. Das Nein-Lager habe 20-mal weniger Geld zur Verfügung, könne jedoch mit 1.8 Milliarden Franken Steuerausfällen argumentieren. Dieser Vergleich empfindet ein Beanstander als unzulässig. Es würden verschiedene Ebenen miteinander verglichen.
Was sagt die Redaktion?
Der Begriff «fiktives Einkommen» im Zusammenhang mit dem Eigenmietwert ist nach Ansicht der verantwortlichen Redaktion umgangssprachlich der verständlichere Begriff, um den Eigenmietwert zu definieren. Allerdings sei der Begriff juristisch und ökonomisch nicht ganz korrekt, räumt die Redaktion ein.
Nach Ansicht der Redaktion habe der Begriff die Meinungsbildung des Publikums jedoch nicht beeinflusst. Er werde bei der aktuellen Abstimmung auch nicht als «Kampfbegriff» einer Seite verwendet.
Um präziser zu sein, verzichte man in Zukunft auf diesen Ausdruck oder verwende ihn allenfalls in abgemilderter Form (etwa «eine Art fiktives Einkommen»), versichert die Redaktion.
Was sagt die Ombudsstelle?
Die Ombudsleute weisen darauf hin, dass in der politischen Diskussion um den Eigenmietwert die Frage effektiv strittig sei, ob es sich beim Eigenmietwert um einen Einkommensbestandteil (Naturaleinkommen) handle oder ob es lediglich um ein «fiktives», das heisst angenommenes, erdachtes Einkommen gehe. Der Ausdruck «fiktives Einkommen» sei keine allgemein übliche Begriffswahl, sondern eine bewusste Wortwahl von Kritiker:innen der Eigenmietwertbesteuerung. Deshalb dürfe die Begrifflichkeit gemäss den Ombudsleuten im redaktionellen Teil einer Sendung nicht unkommentiert verwendet werden.
Die Verwendung dieses Begriffs allein führe jedoch noch nicht zu einer Verletzung der Sachgerechtigkeit. Es sei zu prüfen, ob damit die freie Meinungsbildung des Publikums effektiv beeinträchtigt worden sei oder ob es sich um einen Fehler in einem Nebenpunkt handle.
Bei beiden beanstandeten «Tagesschau»-Beiträgen habe der Fokus nicht auf der Fragestellung der Eigenmietwertbesteuerung als solcher gelegen. Allerdings gelte in der Phase vor Volksabstimmungen eine erhöhte journalistische Sorgfaltspflicht
So verstosse der «Tagesschau»-Beitrag vom 18. Juli 2025 gegen das Gebot der Sachgerechtigkeit. Denn der umstrittene Begriff werde nebst der Anmoderation auch im Beitrag verwendet. Er werde bei der Erklärung der Funktionsweise der Eigenmietwertbesteuerung unkommentiert als faktisch unbestrittene Tatsache stehen gelassen.
Bei der «Tagesschau» vom 12. Juli 2025 sehen die Ombudsleute das Sachgerechtigkeitsgebot der Sendung insgesamt nicht verletzt. Der Begriff «fiktives Einkommen» falle nur in der Anmoderation des Beitrags und stelle somit einen Fehler in einem Nebenpunkt dar.
Im beanstandeten Beitrag der «Tagesschau» vom 22. August 2025 erwähne der SRF-Journalist in seinem Abschlusskommentar die unterschiedlichen Kampagnen-Budgets der beiden Komitees. Er relativiere jedoch die Bedeutung des grossen Unterschieds der zur Verfügung stehenden Gelder. Er weise darauf hin, dass das Nein-Komitee die Steuerausfälle von rund 1.8 Milliarden Franken ins Zentrum seiner Argumentation stelle.
Zwar sehen die Ombudsleute zwischen der Höhe der Kampagnenbudgets und der Summe der möglichen Steuerausfälle sachlogisch keinen Zusammenhang. Es sei jedoch bei der Kommentierung der Umfrageergebnisse darum gegangen, die relativ klare Ja-Mehrheit der Umfrage einzuordnen und zu fragen, ob eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse noch möglich sei. Die grösseren finanziellen Möglichkeiten des Ja-Komitees würden eher für eine Verstärkung des Ja-Trends sprechen. Es ist in den Augen der Ombudsleute zulässig, auf ein Argument der Gegner hinzuweisen, welches diese im weiteren Abstimmungskampf vermehrt ins Zentrum rücken wollen. Die Ombudsleute können keinen Verstoss gegen das Sachgerechtigkeits- und Vielfaltsgebot erkennen.
Weitere Schlussberichte zum Thema:
Weitere Schlussberichte zum Thema: