SRF «DOK»-Film «Organspende – Ich will leben» beanstandet

6267
Mit Ihrer E-Mail vom 8. Januar 2020 haben Sie den «Dok»-Film «Organspende – Ich will leben» (3/4)[1] vom 19. Dezember 2019 beanstandet. Ihre Eingabe erfüllt die formalen Voraussetzungen an eine Beanstandung. Somit kann ich auf sie eintreten.
A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
E-Mail vom 8. Januar 2020:
Um die Eingabefrist nicht zu verpassen, hatte ich bereits Ende Dezember mit einer Kopie des unten stehenden Schreibens, das an die Direktion des SRF ging, bei Ihnen eine Beanstandung eingereicht mit der Mitteilung, dass die Beanstandung nichtig sei, wenn die Direktion auf meine Forderung eingehe.[2] Da dies nicht der Fall ist, respektive mein Schreiben nicht an die Direktion weitergeleitet wurde, möchte ich definitv eine Beanstandung einreichen. Hier nochmals unser Schreiben:
E-Mail vom 31. Dezember 2019:
Ich habe die unten stehende Zeilen am 27.12.2019 an die Direktion des Schweizer Fernsehens gesendet. Sie wird mein Schreiben in der 2. Kalenderwoche 2020 bearbeiten. Um aber nicht die Frist für eine Beanstandung zu verpassen, sende ich auch Ihnen dieses Schreiben als Beanstandung zu. Sollte die Direktion auf mein Anliegen eintreten, erübrigt sich diese Beanstandung selbstverständlich.
In den vier Folgen der DOK-Sendung «Organspende - Ich will leben» wird das Thema Organspende unseres Erachtens nicht ausgewogen dargestellt.
Der Anteil der Sendung, der die befürwortende Haltung gegenüber der Organspende unterstützt, ist viel grösser als derjenigen, der kritische Aussagen enthält. Berührende Berichte von kranken Menschen und hoffenden Angehörigen überwiegen. Unseres Erachtens entsteht, trotz einigen kritischen Aussagen, insgesamt der Eindruck, dass beim Thema Organspende alles in Ordnung sei.
Angehörige, die der Organspende bei ihrem hirntoten Familienmitglied zustimmen, können ihre Beweggründe darlegen, hingegen kommen die Angehörigen, die die Organspende bei ihrem Familienmitglied ablehnen (eine Merheit von 60%), nicht zur Sprache. Deren Argumente und Überlegungen werden in der Sendung nicht aufgezeigt.
Die Explantation der Organe wird (aus gebührender Distanz) gezeigt, nicht aber der emotional kritischste Teil, die Entnahme des Herzen. Damit entsteht bei den Zuschauerinnnen und Zuschauern möglicherweise der Eindruck, Explantationen seien unproblematisch und unumstritten.
Bei Menschen, die kritische Aussagen machen, wie die Pflegefachperson, die mit der hirntoten Patientin spricht, erfolgt kein vertiefendes Gespräch.
Es wird erwähnt, dass es medizinische Fachpersonen gibt, die bei Explantationen nicht mitarbeiten (wollen oder können). Auch sie werden aber in der Sendung nicht gezeigt und sie können ihre Beweggründe nicht aufzeigen. Hingegen kommen Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen, die Organtransplantationen befürworten, ausgiebig zur Sprache.
Als Schweizer Fernsehen sind Sie einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Unseres Erachtens wäre es deshalb notwendig, nach diesen vier insgesamt befürwortenden Sendungen zur Organspende auch in einer Sendung Personen, die Organspenden ablehnen, zu Wort kommen zu lassen.
Wir sind gerne bereit, unsere Sicht auf die Organspende darzulegen.
B. Ihre Beanstandung wurde der zuständigen Redaktion zur Stellungnahme vorgelegt. Herr Marc Gieriet, Leitung DOK-Serien SRF, schrieb:
Gerne nehme ich als leitender Produzent der DOK-Serien Stellung zur Beanstandung von Herrn X zur DOK-Sendung «Organspende – Ich will leben!» vom 19. Dezember 2019.
Zum Vorwurf von Herrn X zur vierteiligen Serie, dass «der Anteil der Sendung, der die befürwortende Haltung gegenüber der Organspende unterstützt, (...) viel grösser» sei als derjenige, der kritischen Aussagen, möchte ich mit der Erläuterung der grundlegenden Vorgehensweise der Redaktion bei der Auswahl und Umsetzung des Themas «Organspende» eingehen:
Das Transplantationsgesetz, das vom Schweizer Parlament am 8. Oktober 2004 verabschiedet wurde, sieht vor, dass bestimmte Organe, Gewebe und Zellen unter klar geregelten Bedingungen transplantiert werden dürfen. Dieses Gesetz steckt gewissermassen den Rahmen ab, in welchem wir uns thematisch mit der beanstandeten Sendung bewegen. Die Sendung hatte zum Ziel, dem Publikum unter Berücksichtigung dieses gesetzlich klar geregelten Rahmens, eine persönliche Abwägung zu ermöglichen: Nämlich - will ich meine Organe nach meinem Tod zur Verfügung stellen oder nicht? Die Sendung hatte nicht zum Ziel, ein allfälliges Verbot der Organtransplantation zu diskutieren, weil es dafür aus redaktioneller Sicht keinen Anlass gibt. Jeder Mensch in der Schweiz hat die Freiheit, seine Organe zu spenden oder auch nicht zu spenden. Dafür braucht er keine weiteren Argumente aufzuführen. Es gibt also aktuell keinen redaktionellen Grund, eine legale Situation, in der jeder Mensch sein Tun frei wählen kann, grundsätzlich infrage zu stellen.
Herr X bemängelt, «es entstehe insgesamt der Eindruck, dass beim Thema Organspende alles in Ordnung sei.» Diese Ansicht kann ich insofern teilen, als dass rechtlich und medizinisch tatsächlich alles «in Ordnung», nämlich gesetzlich und medizinisch geregelt ist. Die Organspende ist einerseits legal und andererseits naturwissenschaftlich-medizinisch anerkannt. Das heisst nicht, dass uns verschiedene Meinungen bzw. unterschiedliche Haltungen zu Leben und Tod nicht interessieren würden. Diese werden unseres Erachtens nach in der Serie angemessen angesprochen.
Keinesfalls wollte die DOK-Serie das Thema journalistisch unkritisch behandeln. Dies haben wir u.a. damit erreicht, dass wir aufzeigen, mit welchen negativen Konsequenzen der Mensch allenfalls zu rechnen hat. Die ehemalige Spitzensportlerin Nicola Heyser z.B. lebt seit zehn Jahren mit einem Spenderherz. Die permanente Einnahme von Immunsuppressiva führt zu erhöhtem Krebsrisiko. Nicola Heyser musste bereits wegen Hautkrebs operiert werden. Sie bekam vor fünf Jahren eine Spenderlunge. Jetzt leidet sie unter einer chronischen Abstossung. Auch diese Komplikationen werden in der Serie ungeschönt thematisiert.
Ebenfalls wird ethischen Fragen Platz eingeräumt, insbesondere in der Szene, in welcher eine Pflegefachfrau mit einer Verstorbenen spricht, während sie diesen für die Organentnahme vorbereitet. Auch hier gilt: Die Frage, zu welchem Zeitpunkt ein Mensch tot ist, ist in der Schweiz klar geregelt. Eine solche Abklärung des Todeskriteriums, nämlich die Feststellung des Hirntods, wurde im Ablauf transparent gezeigt. Selbstverständlich können diese Szenen im Publikum unterschiedliche Überlegungen und auch Emotionen hervorrufen und die persönliche Haltung zum Thema prägen - genau das sollen diese Bilder auch. Jede und jeder im Publikum kann und darf für sich eine abweichende Meinung zum Tod, zur Seele und zum irdischen Dasein haben. Diese Freiheit wurde durch die Darstellung nie begrenzt oder infrage gestellt.
Herr X merkt im Zusammenhang mit dieser Szene an, dass die Pflegefachperson «kritische Aussagen» mache und kritisiert, dass zu dieser Kritik «kein vertiefendes Gespräch» erfolge. Dass die Aussagen der erwähnten Pflegefachfrau auf einer kritischen Haltung gegenüber der Organtransplantation gründen, ist eine freie Interpretation des Beanstanders. Vielmehr entspricht es der persönlichen Überzeugung der Frau, einer verstorbenen Person denselben Respekt und dieselbe Behandlung zukommen zu lassen, wie einer lebenden Person. Es entspricht aus diesem Grund auch nicht den Tatsachen, dass das Gespräch von Seiten der Redaktion nicht weiter vertieft wurde. Die Frau hatte gesagt, was es aus ihrer Sicht zu sagen gab. Selbstverständlich hatten wir ihr die Möglichkeit gegeben, auch weiterführende Gedanken zu äussern.
In einem weiteren Punkt moniert Herr X, dass die Explantation der Organe aus gebührender Distanz gezeigt wurde, der «emotional kritischste Teil, die Entnahme des Herzens» jedoch nicht gezeigt werde. Damit entstehe im Publikum möglicherweise der Eindruck, Explantationen seien unproblematisch und unumstritten. Dazu möchte ich gerne auf die bereits aufgeführte Argumentation hinweisen, wonach eine Explantation juristisch und medizinisch tatsächlich unumstritten ist. Die Rezeption des Publikums hingegen ist tatsächlich oft eine andere Sache. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, war es für uns entscheidend, das Publikum in den Leidensprozess der Protagonistinnen und Protagonisten mit einzubinden. Wer der 8-jährigen Mireya und ihren Eltern durch die Serie gefolgt ist, wer das Leiden der ganzen Familie Laurent oder des Herzpatienten Bruno Romang mitverfolgt hat, wer sieht, mit welcher Mühe sich der COPD-Patient Christian Reutemann durch seinen Alltag schleppt, konnte sich leicht davon überzeugen, dass eine Organtransplantation das Zweitletzte ist, was sich ein gesunder Mensch wünscht.
Dass wir die Explantation des Herzens nicht detailgetreu gezeigt haben, hatte nicht ethische Gründe, vielmehr wurde in keiner der gefilmten Sequenzen ein Herz entnommen. Selbstverständlich hätten wir auch eine Herzentnahme in angemessener Form gezeigt. Dass dieser Aspekt nicht explizit bildlich dargestellt wurde, veränderte die Gesamtdarstellung unseres Erachtens aber nicht wesentlich.
Ungenau interpretiert wurde ausserdem die kurze Sequenz, in welcher gesagt wird, dass medizinische Fachpersonen, welche an einer Explantation nicht teilnehmen wollen oder können, diese Freiheit durchaus hätten. Auch dies als Zeichen, dass andere Meinungen, Haltungen oder ganz individuelle Überlegungen selbst innerhalb dieses Spitals durchaus Platz haben. Hingegen ist der Schluss falsch, dass dieser Fall immer wieder eintritt. Laut den Verantwortlichen des Inselspitals komme dies praktisch nie vor.
Das Thema Organspende «sei nicht ausgewogen dargestellt worden», kritisiert der Beanstander. In mathematischer Hinsicht mag das stimmen. Herr X verweist auf die Mehrheit von 60% unter den Angehörigen, die eine Organspende bei ihrem Familienmitglied ablehnen. Demgegenüber steht eine grössere Mehrheit in der Gesamtbevölkerung, welche sich in Umfragen regelmässig für die Organspende ausspricht.
Der Nutzen einer Organspende wurde definitiv stärker betont, als die Nachteile. Aus redaktioneller und journalistischer Sicht, aber auch von einem humanistischen Standpunkt aus scheint uns dies legitim. Zu dokumentieren, wie man ein Leben mit allen legal zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten versucht, gewichten wir höher als die unbewiesenen Einwände, eine juristisch und medizinisch für tot erklärte Person könnte in irgendeiner Art und Weise Schaden erleiden. Wenn einem Lebendspender die Schmerzen einer Entnahme der Niere oder Teile der Leber erfahrungsgemäss und nachweislich zuzumuten sind, dann dürfte das nicht bewiesene, allfällige Leiden eines verstorbenen Organspenders erst recht zu rechtfertigen sein, wenn damit ein Leben gerettet wird.
Niemand wird angesichts der gezeigten Protagonistinnen und Protagonisten in Abrede stellen, dass die Möglichkeit der Organtransplantation insbesondere für die Betroffenen und Angehörigen ein Segen ist. Ein Teil der Menschen, die in der Serie zu Wort kamen und deren Schicksal gezeigt wurde, wären nicht mehr am Leben ohne diese medizinischen Möglichkeiten. Ebenfalls kann leicht überprüft und nachgewiesen werden, dass keine der gezeigten Ärztinnen, Ärzte oder Pflegefachpersonen in der Sendung je explizit eine Aussage pro Organspende gemacht haben. Sie haben stets medizinisch argumentiert oder zu offenen Fragen Stellung genommen, ohne je ein Richtig oder Falsch zu proklamieren.
Die Sachgerechtigkeit ist und war uns das grösste Anliegen in der dokumentarischen Bearbeitung des Themas Organspende. Diesen Anspruch haben wir unseres Erachtens eingelöst. Wir sind überzeugt, dass sich das Publikum dank der Serie «Organspende – ich will leben!» eine unabhängige Meinung bilden konnte. Wir sind der Meinung, die Beanstandung sei abzuweisen.
C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Die vierteilige «DOK»-Serie zeigt Lebensgeschichten von Patientinnen und Patienten auf der Warteliste, den Verlauf einer Organentnahme und auch Menschen, die seit Monaten oder Jahren mit dem Organ einer fremden Person leben. Es wird gezeigt wie Angehörige, die sich in Anbetracht des tragischen Todes eines Familienmitglieds rasch entscheiden müssen, ob sie mit einer Organspende einverstanden sind oder nicht. Es geht des Weiteren um Ärztinnen und Ärzte, die sich immer wieder mit medizinischen und ethischen Fragen rund um die Organtransplantation konfrontiert sehen. Schon im Sendungsbeschrieb[3] wird klar, dass der Fokus der vier «Dok»-Folgen darauf gelegt wird, dem Publikum unter Bezugnahme zum gesetzlich geregelten Rahmen, eine individuelle Einschätzung zu ermöglichen: Möchte ich meine Organe nach dem Tod jemandem zur Verfügung stellen oder nicht? In der «Dok»-Serie werden Geschichten von Menschen verschiedensten Alters, die auf ein Organ warten oder bereits erhalten haben, und ihr Umfeld gezeigt; so beispielsweise ein achtjähriges Kind, eine Mutter von drei Kindern, deren Mann sich entscheidet, ihr einen Teil seiner Leber zu spenden, ein Zimmermann mit einem Kunstherz oder eine ehemalige Spitzenreiterin. Es wird aber auch die Seite der Organspenderinnen und Organspender beleuchtet.
Sie kritisieren zur Hauptsache die mangelnde Ausgewogenheit bezüglich einer befürwortenden versus einer ablehnenden Haltung der Organspende gegenüber. Ein Pro und Kontra Organspende war indes nicht das Ziel der «Dok»-Serie. Vielmehr ging es – wie oben ausführlich dargelegt – darum, dass sich das Publikum mit der Frage, ob man seine Organe nach dem Tod jemandem zur Verfügung stellen will oder nicht, differenziert und kritisch auseinandersetzen kann. Dazu trugen die vielen eindrücklichen und aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchteten Beispiele bei.
Zudem gilt für den Veranstalter die gesetzlich zugestandene Programmautonomie (RTVG, Art. 6 Abs. 2)[4]: Solange sich das Publikum frei eine eigene Meinung bilden kann, sind die Journalistinnen und Journalisten frei, wie sie ein Thema anpacken wollen. Zur Programmautonomie gehört beispielsweise die Wahl eines Themas, die Auswahl der Gesprächspartner oder die Definition der Fragestellung. Verlangt wird selbstverständlich, dass eine Sendung sachgerecht ist. In keinem der vorhin erwähnten Punkte kann ich den Verantwortlichen etwas vorwerfen. Ausserdem wurden zu keinem Zeitpunkt seitens des medizinischem Fachpersonals explizite Aussagen pro Organspende gemacht. Die portraitierten Personen haben ausschliesslich fachbezogene Argumente geliefert oder bei offenen Fragen persönlich Stellung genommen, ohne jedoch ein positives oder negatives Urteil über die Organspende abzugeben. Herr Marc Gieriet hat Ihnen in seiner ausführlichen Stellungnahme auf die weiteren von Ihnen kritisierten Punkte detailliert Antwort gegeben. Ich kann ihm in sämtlichen Punkten beipflichten.
Die «Dok»-Serie «Organspende – Ich will leben!» war sachgerecht; es wurden keinerlei Fakten verdreht oder verfälscht. Das Publikum wurde zu keinem Zeitpunkt manipuliert und konnte sich frei eine eigene Meinung bilden. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass ich Ihre Beanstandung nicht unterstützen kann.
D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung. Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen,
Manfred Pfiffner, stv. Ombudsmann
[1] DOK-Serie «Organspende – Ich will leben!» (1/4):
https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/organspende---ich-will-leben-14?id=331d0217-3ab4-463a-bebf-906af4e727b6
DOK-Serie «Organspende – Ich will leben!» (2/4):
https://www.srf.ch/play/tv/dok/video/organspende---ich-will-leben-24?id=f239073e-896d-4447-b7da-112be0c21b8a
DOK-Serie «Organspende – Ich will leben!» (3/4):
DOK-Serie «Organspende – Ich will leben!» (4/4)
[2] Der E-Mail-Verkehr zwischen Ihnen und Herrn Marc Gieriet, Leitung DOK-Serien SRF, findet sich in der Anlage.
[3] https://medien.srf.ch/-/-dok-serie-organspende-ich-will-leben
[4] https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001794/201607010000/784.40.pdf

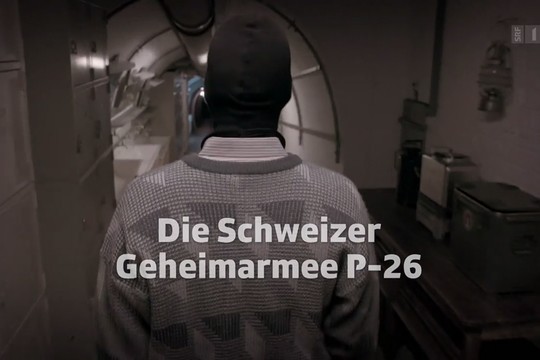

Kommentar