Susanne Brunner: «Die internationale Newslage ist für viele deprimierend»

Gerade in der heutigen Zeit sei Auslandsberichterstattung so wichtig wie noch nie zuvor, ist Susanne Brunner überzeugt. Die ehemalige Korrespondentin leitet heute die Auslandredaktion von Radio SRF – und ist selbst immer wieder im Nahen Osten auf Reportage. Nicht ohne Risiko.
Zur Person
Zur Person
Susanne Brunner wurde 1964 in Wetzikon im Kanton Zürich geboren. Im kanadischen Ottawa studierte sie.Journalismus und begann 1986 beim damaligen Radio DRS 3 als Moderatorin und Redaktorin. Später wurde sie USA- und Romandie-Korrespondentin. 2006 wechselte Susanne Brunner zur Radiosendung «Tagesgespräch», wo sie elf Jahre lang als Gesprächsleiterin wirkte. 2018 wurde sie Nahostkorrespondentin in der jordanischen Hauptstadt Amman. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz übernahm sie 2023 die Leitung der Auslandredaktion von Radio SRF. Heute wohnt Susanne Brunner im Glarnerland und reist als Auslandredaktorin weiterhin nach Israel/Palästina.
Susanne Brunner, warum braucht es Korrespondentinnen und Korrespondenten überhaupt?
Man könnte ja auch einfach Artikel von «Le Monde», «New York Times» oder «Al-Jazeera» übersetzen. Den Augenschein vor Ort kann man nicht ersetzen. Nur so lernt man die Kultur kennen, die Sprache und die Leute. Von SRF wird erwartet, dass wir die Orte, über die wir berichten, selbst besuchen und nicht einfach möglicherweise zensierte oder unausgewogene Beiträge übernehmen. So kann man Ereignisse anders einschätzen, als wenn man nur darüber liest. SRF begann 1947, damals noch als Radio Beromünster/DRS, mit dem Aufbau des Korrespondentennetzes sowie eines Netzes von Leuten vor Ort, die mit uns zusammenarbeiten. Dieses Wissen wird weitergegeben und hilft auch bei der Verifikation: Wir merken schnell, wenn eine Information nicht stimmen kann. Zudem finde ich wichtig, dass es Schweizer Augen und Ohren sind, die auch unsere Kultur und Politik hier kennen, um die Ereignisse richtig einzuordnen und in einen für unser Publikum relevanten Kontext stellen zu können.
Warum ist es wichtig zu wissen, was in anderen Ländern geschieht?
Die Schweiz ist sehr international. Sie ist Depositarstaat der Genfer Konventionen, hier haben zahlreiche internationale Organisationen ihren Sitz. Auch die Politik betont oft, dass die Schweiz international eine wichtige Rolle spielt, weil sie als neutraler Staat Friedensvermittlungen übernehmen kann. Was in Gaza, der Ukraine oder im Sudan passiert, hat irgendwann auch eine Auswirkung auf uns. Deshalb ist es wichtig, informiert zu sein. Wir sehen, dass es Schweizerinnen und Schweizer tatsächlich auch interessiert, was im Rest der Welt geschieht. Vielleicht auch, weil wir ein sehr reisefreudiges Land sind. Nicht zuletzt sehe ich diese Neugier für andere Länder auch, wenn ich eine Schulklasse besuche: Dort gibt es längst nicht mehr nur Meiers und Müllers, sondern Kinder unterschiedlicher Herkunft, die unterschiedliche Sprachen sprechen – dies finden die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden interessant. Das widerspiegelt sich beispielsweise in der Themenwahl für Maturaarbeiten gewisser Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Die internationale Newslage ist aktuell für viele Leute auch deprimierend. Sie haben keine Lust, jeden Tag von Kriegen und Katastrophen zu hören. Ich glaube, was Mühe macht oder deprimierend ist, sind Schlagzeilen und Nachrichten über Bombardierungen, Unfälle und Naturkatastrophen ohne jegliche Einordnung. Dabei ist Einordnung die beste Art, wie wir mit Leid umgehen können. Darüber müssen wir miteinander reden, auch wenn es nur mit der Person ist, die einem ein Gipfeli verkauft am Morgen. Diese menschliche Ebene geht immer mehr verloren in der digitalen Welt. Das Erleben und auch der Journalismus sind schlussendlich sehr analog. Natürlich gibt es beide Welten, aber das Menschliche im Journalismus ist essenziell. Deshalb geht es uns vor allem auch darum, zu berichten, wie die Menschen mit politischen Entscheidungen oder Katastrophen umgehen. Das schafft mehr Bezug, als zu erfahren, wie viele Raketen jetzt schon wieder abgeschossen worden sind.
Zurzeit gibt es praktisch jeden Tag einen neuen Artikel zu Donald Trump. Ist er wirklich so relevant?
Wir überlegen bei SRF immer, wie wir auf Themen kommen, die über die aktuellen Nachrichten hinausgehen. In den USA haben wir zwei Personen, sie gehen zwischendurch extra in eine ganz andere Region des Landes und machen eine Reportage zu einem Thema, das nichts mit Trump zu tun hat – weil es noch ganz viel anderes gibt, das die Menschen dort bewegt. Das tun wir auch in anderen Ländern. Kürzlich haben wir etwa eine «International»-Sendung gemacht zu Spanien, das führend ist in der Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Das ist ein positives Thema, das man nicht sofort mit Spanien in Verbindung bringt. Wir haben auch geschaut, was die Schweiz davon lernen kann.
«Solche Geschichten entdeckt man nur, wenn man wirklich vor Ort lebt und nicht einfach von anderen Medien abschreibt.»
Wie kommt man als Korrespondentin oder Korrespondent zu Themen und zu einem Netzwerk?
Wir haben gewisse einheimische Leute vor Ort, die schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten mit uns arbeiten. So habe auch ich meinem Nachfolger im Nahen Osten mein Kontaktbuch weitergegeben und erklärt, wer zum Beispiel helfen kann beim Organisieren von Interviews. In anderen Ländern funktioniert es oft ganz anders als in der Schweiz; bei einigen Pressestellen erhält man nie eine Antwort, ausser man kennt jemanden, der jemanden kennt. Deshalb ist immens wichtig, mit wertvollen Kontakten weiterzuarbeiten. Natürlich lernen aber auch die Journalistinnen und Journalisten mit jeder Reise neue Menschen kennen und bauen so ihr eigenes Netzwerk auf. Die Wechsel auf den Korrespondenzposten alle vier bis sechs Jahre braucht es aber trotzdem, sonst entwickelt man eine zu grosse Nähe zur Region und zu den Menschen, über die man berichtet. Da ist man nicht mehr so unbefangen. Ausserdem träumen viele Journalistinnen und Journalisten von einer Korrespondenzstelle. Auch deshalb braucht es Erneuerung, damit Jüngere Erfahrungen sammeln können, mit denen sie später in die Redaktion zurückkommen – was wiederum die Berichterstattung von hier über das Ausland besser macht. Viele Korrespondentinnen und Korrespondenten bringen zudem eine grosse Portion Gelassenheit zurück ins Haus, sie kommen nicht soschnell aus der Ruhe (lacht).
Wozu braucht es neben den Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland auch eine Fachredaktion in Bern?
Beim Frühdienst ab vier Uhr morgens ist unsere Rolle, einzuschätzen, was an diesem Tag wichtig ist auf der Welt. Wir haben auch einen späteren Dienst am Nachmittag und verfolgen die Entwicklungen laufend. Wir sind stets in Kontakt mit diversen Sendungen und der Onlineredaktion und analy sieren die Lage, liefern Beiträge. Zudem ist die Auslandredaktion ein wichtiger Anker für die Korrespondentinnen und Korrespondenten ausserhalb der Schweiz. Jede und jeder von uns betreut eine Person im Ausland, bespricht mit ihr die Themen, Publizistisches, ist auch mal Klagemauer, wenn es jemandem nicht so gut geht. Unsere dritte Funktion ist, die Flecken der Welt abzudecken, wo wir keine fixen Korrespondentinnen und Korrespondenten haben. Der Westbalkan zum Beispiel wird von einem Redaktor in der Schweiz betreut. Für Ihre Berichterstattung über den Nahen Osten wurden Sie 2024 als Journalistin des Jahres ausgezeichnet.
Sie waren aber auch Kritik ausgesetzt. Wie gehen Sie mit polarisierenden Meinungen um?
Es gibt die Welt der Internetmedien, und es gibt die reale Welt. Wenn ich in der Schweiz Menschen bei Veranstaltungen begegne oder sie mich anrufen, dann sind die Gespräche sehr konstruktiv und inspirierend – auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Womit ich allerdings grosse Mühe habe, sind die Meinungen in den sozialen Medien. Dort geht es meistens gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern die Menschen wollen irgendetwas loswerden. Die sozialen Medien sind oft wie ein Abfallkübel für üble Gefühle. Seit Corona hat das meiner Meinung nach zugenommen. Kritik kannte ich natürlich auch schon vorher, etwa, als ich das «Tagesgespräch» moderierte. Da erhielt ich zum Teil E-Mails, in denen stand, es gebe keine Inkompetentere als mich. Wenn ich dann jeweils angerufen habe, dann klangen diese Leute am Telefon aber schon ganz anders.
«Deshalb ist der Dialog so wichtig.»
Wie geht man mit der eigenen Perspektive auf die Welt um, mit den eigenen blinden Flecken?
Journalismus ist ein Handwerk wie jedes andere. Zuerst muss man sich bewusst werden, wo man selber steht. Uns ist vor allem die journalistische Haltung wichtig. Unsere Publizistischen Leitlinien basieren auf den Genfer Konventionen und dem Völkerrecht. Wer für uns arbeitet, wird aber nicht einfachlos geschickt und alleingelassen. Auch ein Korrespondent arbeitet in einem Team, mit Leuten der SRF-Redaktionen in Bern oder in Zürich. Und ich betone immer wieder: Wir sind keine Bots – man kann mir schreiben, mich anrufen und mit mir diskutieren. Diesen Dialog mit Hörerinnen oder Usern finde ich extrem wichtig und aufschlussreich – auch das hilft gegen blinde Flecken.
Wie geht SRF mit dem immer komplexeren Weltgeschehen um?
Die Welt wird vor allem für uns im Westen immer komplexer. Wir finden das alles sehr chaotisch. Der grösste Teil der Welt aber lebt das Chaos und die Katastrophe jeden Tag. Wir kritisieren die Weltwirtschaft und die US-Zölle, während ein Grossteil der Welt nicht einmal 24 Stunden am Tag Strom hat. Deshalb würde ich sagen, die Korrespondentinnen und Korrespondenten sind besser gewappnet, um mit dem komplexen Weltgeschehen umzugehen. Im arabischen Raum habe ich übrigens häufig miterlebt, dass über den Westen Witze gemacht wurden, weil seine Medien jene Zustände «Chaos» nannten, die im Nahen Osten als völlig «normal» angesehen wurden.
Und wie gehen Sie als Chefin damit um? Sie müssen ja jetzt den Überblick über jeden Weltteil haben, nicht nur den Nahen Osten.
Das finde ich fast am schwierigsten – es geschieht so viel in so vielen Ecken der Welt, dass wir alle sehr stark eingebunden sind in die Berichterstattung über die Aktualität. Wir kommen kaum mehr zum Nachdenken. Ich war kürzlich mit einem Korrespondenten am Telefon, der sich beklagte, seine Weltgegend interessiere die Sendungen neben der Kriegsberichterstattung in der Ukraine oder im Nahen Osten kaum noch. Eine halbe Stunde später musste er wegen einer Naturkatastrophe aus dem Haus rennen. Da war er auf einmal fast nonstop auf dem Sender. Für mich ist das symptomatisch: Wir wissen nie, was passieren wird. Das viel grössere Problem ist der Angriff auf die Pressefreiheit und der daraus resultierende Backlash gegen die Demokratie. Für Korrespondentinnen und Korrespondenten ist es immer schwieriger, ein Visum zu erhalten, und auch die Gefahrenlage spitzt sich zu. Diese Verantwortung, kombiniert mit meinem Job als Auslandredaktorin, und dann noch die ganze Reorganisation von SRF – das ist viel und bringt mich manchmal an die Grenze dessen, was ich leisten kann.
Spüren Sie bei SRF auch eine gewisse Verantwortung, weil sich viele Schweizer Medien kein Korrespondenznetz mehr leisten?
Auslandsberichterstattung ist von immenser Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit, in der es wichtiger denn je ist, zu verstehen, was passiert, wie die globalen Zusammenhänge aussehen und wie sich eine Entwicklung auf die Schweiz auswirkt. Ich bemühe mich, dass dieses Korrespondenznetz gewährleistet bleibt. Momentan müsste man dieses eher noch ausbauen, weil so viel passiert und so viel auf mehreren Ebenen zusammenspielt. Die Welt einzuordnen, gehört zur öffentlich finanzierten Berichterstattung.
Näher dran mit dem Mitgliedermagazin
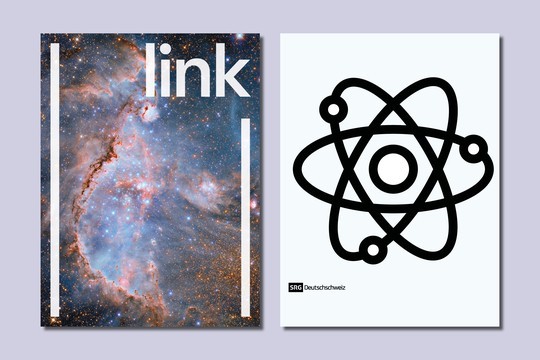
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt Mitglied werden

