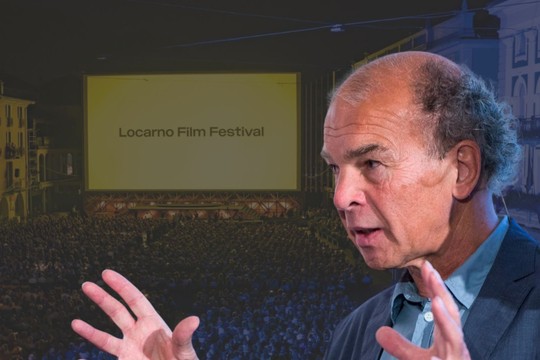Regionaljournalismus in der Krise – gibt es noch eine Zukunft für Lokalberichterstattung?
Der Regional- und Lokaljournalismus spürt die Medienkrise am stärksten: Sinkende Einnahmen durch Werbung und Abonnemente sorgen in den letzten Jahren für einen Rückgang der lokalen Berichterstattung. Im Rahmen unserer neuen Talkreihe «SRG.Diskutiert» haben wir in der Zentralschweiz mit verschiedenen Akteur:innen über Herausforderungen und Zukunftsvisionen im Regionaljournalismus gesprochen.
Zu den Personen
- Fabian Muster, Studienleiter Lokaljournalismus am MAZ
- Christian Oechslin, Co-Redaktionsleiter Regionaljournal Zentralschweiz
- Federico Gagliano, Stv. Ressortleiter Kanton bei der «Luzerner Zeitung»
- Flavia Rivola, Redaktionsleiterin «Surseer Woche»
Die regionale und lokale Berichterstattung hat gerade in der Schweiz mit ihren kleinteiligen Kulturräumen und dem ausgeprägten Föderalismus eine besondere Bedeutung. Laut einer Studie der Fachhochschule Graubünden (FHGR) zählte die Schweiz 2022 489 Lokalmedien, aufgeteilt in 374 Printzeitungen, 63 Lokalradios, 27 Lokalfernsehsender und 52 reine Onlinemedien. Die Titel sind auch wichtig für die Schweizer Medienlandschaft. Viele Journalist:innen sammeln ihre ersten Erfahrungen bei regionalen Titeln.
Doch heute steht die Lokalberichterstattung unter Druck: Während die Zeitungen in zehn Jahren um 104 Titel zurückgegangen sind, kamen digital nur deren 50 hinzu – viele lokale Medien bereitet die digitale Transformation grosse Mühe. Was leidet, ist die Vielfalt im Gesamtangebot.
Damit ist die Schweiz nicht alleine. In den USA spricht man heute von «News-Wüsten», also Gebieten, in denen es keine lokalen Medienangebote mehr gibt. Oder in Deutschland kommt die Studie «Wüstenradar» der Hamburg Media School zum Schluss, dass es zwar noch keine Wüste, aber eine «Versteppung» der Medienlandschaft, gebe.
Fabian Muster ist Studienleiter Lokaljournalismus am MAZ Institut für Journalismus und Kommunikation. Auch kennt den Wert einer funktionierenden kommunalen Berichterstattung. «Der Lokaljournalismus ist der Watchdog der lokalen Politik, schaut den dortigen Politiker:innen auf die Finger», sagt er. Journalismus aus der direkten Lebensumgebung fördere die Demokratie: «Dort, wo es lokale Medien gibt, nehmen die Leute mehr an Wahlen und Abstimmungen teil.» Das Angebot sei zudem identitätsstiftend und fördere das Gefühl für Zusammenhalt, so Muster weiter. Der Schwund von Lokalmedien lässt deshalb beispielsweise die Bereitschaft sinken, sich ehrenamtlich – beispielsweise in Vereinen – zu engagieren. Zu dieser Erkenntnis gelangte unlängst eine Studie der Fachhochschule Graubünden (FHGB).
Für Christian Oechslin, Co-Redaktionsleiter des Regionaljournals Zentralschweiz, sind diese Aspekte teil des Alltags. Er sagt: «Gerade in einem föderalistischen System wie der Schweiz ist es wichtig, dass die Leute informiert sind – insbesondere über das, was vor ihrer Haustüre läuft.» Als Regionalredaktion helfe man den Leuten zu verstehen, was in den Kantonen, Gemeinden und Bezirken läuft und bei Wahlen und Abstimmungen einen informierten Entscheid fällen zu können.
Die SRG nehme denn auch im Regionalen eine wichtige Rolle ein, so MAZ-Dozent Fabian Muster: «Sie hat überall noch Regionalbüros und sorgt so für einen gewissen regionalen News-Teppich – auch dort, wo es vielleicht keine andere lokalen Medien mehr gibt.»
Tatsächlich ist das regionale SRG-Angebot, die Regionaljournale, eine Ergänzung zu den privaten Medienhäusern. Diese machen den Grossteil des lokalen Medienangebots aus. «Der Regionalteil ist, wieso die Leute die ‹Luzerner Zeitung› abonnieren. Man will wissen, was im Kanton, in der Stadt oder der eigenen Gemeinde läuft», sagt Federico Gariglio, stellvertretender Ressortleiter Kanton bei der «Luzerner Zeitung». Der Titel ist Teil des Regionalmedienhauses «CH Media». Die regionale Berichterstattung der «Luzerner Zeitung» wird jeweils durch einen Zentralredaktion produzierten Mantelteil ergänzt. Gariglio sagt aber: «Der Mantelteil ist ein Bonus, aber was hauptsächlich interessiert das, was vor der eigenen Haustüre passiert.»
Und trotzdem: Die Einnahmen sind wie überall in der Branche rückläufig – aber für die kleineren Verlage wird die Situation schneller prekär. Das wirkt sich auch auf das Personal aus. Laut einer Recherche des Onlinemagazins «Republik» verlassen viele Journalist:innen den Beruf, wechseln in andere Felder wie die Kommunikationsberatung, arbeiten in Verwaltungen oder wurden Mediensprecher:innen. Besonders hoch, so das Magazin, sei die Abwanderung im Bereich der regionalen und lokalen Berichterstattung.
Flavia Rivola ging den umgekehrten Weg, kehrte nach mehreren Jahren abseits der Branche in den Journalismus zurück. Sie sagt: «Die Vielseitigkeit macht den Reiz dieses Berufs aus. Man kann vor Ort recherchieren, fotografieren, filmen, den Text verfassen und produzieren – man begleitet den ganzen Prozess von A bis Z.»
Einig sind sich die Befragten über die grössten Herausforderung: die Ressourcen. Oft liessen sich nicht alle interessanten Geschichten umsetzen, weil Zeit oder Geld fehlt, so die Medienschaffenden.
Deshalb brauche es für den Lokaljournalismus neue, zukunftsfähige Lösungen, wie MAZ-Studienleiter Fabian Muster ausführt: «Es braucht Verleger:innen, die an den Lokaljournalismus glauben und auch weiterhin in ihn investieren. Es braucht Leute, die lokale Inhalte konsumieren und dafür auch bezahlen. Und es braucht den Staat oder die Kantone, die dafür sorgen, dass sie finanzielle Unterstützung bereitstellen.»
Nur so sei der Weg zu einem zukunftsfähigen Lokaljournalismus möglich. Wie dieser aussieht? Federico Gagliano von der «Luzerner Zeitung» sagt: «Noch digitaler als bisher, unterstützt durch KI – hoffentlich nur in den kleinen Bereichen und nicht im Gesamten. Aber: Sicher noch existent!»
SRG.Diskutiert: öffentliche Talks über die Medien in der Schweiz
Ab Herbst 2025 bringen die regionalen Mitgliedgesellschaften der SRG Deutschschweiz mit «SRG.Diskutiert» eine neue Talkreihe in die deutschsprachigen Landesteile der Schweiz.
Mehr erfahren