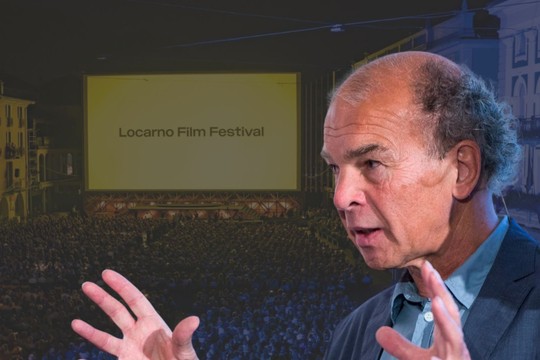Christof Thurnherr: «Die Berichterstattung hat die Gesellschaft berührt»
Zu Beginn dieses Jahres trat das Leitungsteam des neu ausgerichteten Publikumsrats der SRG Deutschschweiz sein Amt an. Im ersten sogenannten Dialogfenster wurde mit der Bevölkerung die Rolle der Medien bei Grossanlässen diskutiert: Was sollen Medien leisten? Und welche Effekte hat die Berichterstattung von Gross-Events auf die Gesellschaft? Christof Thurnherr, Mitglied des Leitungsteams, zieht Fazit.
Christof Thurnherr, das erste Dialogfenster im Resonanzraum des Publikumsrats SRG.D schliesst sich. Das Ziel war, die Rolle der Medien bei zwei Grossanlässen in der Schweiz zu beleuchten: dem Eurovision Song Contest (ESC) in Basel sowie der Women’s EURO. Was sind die zentralen Erkenntnisse aus dem Dialogfenster?
Gezeigt hat sich vor allem eines: SRF ist gewappnet für Grossanlässe. Die Berichterstattung sowohl zum ESC als auch zur Women’s EURO wurde vom interessierten Publikum sowie von Fachpersonen gelobt. Und die Berichterstattung hat die Gesellschaft in beiden Fällen zwar nicht grundlegend verändert, aber zumindest berührt.
Was bedeutet das?
Der Einfluss der Medien auf die Gesellschaft war bei den beiden Gross-Events komplett unterschiedlich. Beim ESC ging es beispielsweise nicht darum, besonders viele Menschen für den Anlass zu begeistern, sondern darum, die sehr heterogene Gruppe der ESC-Interessierten zusammenzuschweissen. Und das hat die Berichterstattung erreicht. Bei der Women’s EURO war es ganz anders: Fussball als Sport verfügt in der Gesellschaft bereits über ein bestehendes breites Interesse. Da ging es darum, Fussball der Frauen in dieser Interessensgruppe stärker zu etablieren, vor allem bei jener Gruppe, die Fussball in erster Linie als Männersport sieht. Und auch hier kann man bilanzieren: Die sorgfältige Berichterstattung von SRF – und auch von anderen Medien – hat dazu beigetragen, das gesellschaftliche Bild des Frauenfussballs zu verändern. Bemerkenswert war auch: SRF war sogar beim langjährigen und stark interessierten Publikum – beispielsweise dem ESC-Fanclub – jeweils die primäre Informationsquelle. Da hätte ich erwartet, dass man seine Informationen spezifischer aus Foren und Blogs bezieht; aber offenbar war die SRF-Berichterstattung genügend umfangreich und qualitativ ansprechend.
Wie unterschieden sich die beiden Events in Bezug auf die Wirkung der Berichterstattung?
Beim ESC ist interessanterweise die Phase vor dem Event extrem wichtig. Die wichtigste Zeit für den Fanclub sind die drei Monate davor: Die Fans wollen Hintergründe zu den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern, setzen sich mit den Songs, den Kostümen und der Show auseinander. Die Final-Events, die im Zeitraum einiger Tage stattfinden, sind schliesslich der Peak der Euphorie. Bei der EM war dies anders. Dort dauert der Event mehrere Wochen. Insbesondere das Fernsehen hat hier auch die Aufgabe, die Spannung aufrechtzuerhalten – und das bei stetig abnehmender Zahl von Livespielen. Was SRF ausserdem gelungen ist: Es hat bei seiner Berichterstattung über die Women’s EURO auf die richtigen Figuren gesetzt.
«Die Clubs spüren in Bezug auf den Frauenfussball bereits einen Effekt.»
Das heisst?
Im Rahmen der EM hat sich die Hintergrundberichterstattung auf verschiedene Spielerinnen konzentriert. Als Beispiel: Lia Wälti war sowohl sportlich auf dem Platz als auch medial omnipräsent. Sie war eine der prägenden Figuren dieser Women’s EURO, und SRF hat dies früh richtig eingeschätzt. Aber nicht nur bei ihr, auch Spielerinnen wie Géraldine Reuteler oder Livia Peng sind heute einem breiteren Publikum in der Schweiz bekannt – natürlich aufgrund ihrer Leistungen, aber eben auch dank der medialen Berichterstattung darüber. Solche Persönlichkeiten helfen am Ende der Entwicklung des Sports: als Vorbilder für Nachwuchsspielerinnen, aber auch als Werbeträgerinnen, um die für die Professionalisierung nötigen Sponsoringgelder zu generieren, beides Zeichen dafür, dass die Vorurteile gegenüber Frauen im Fussball abnehmen. Und, das haben Interviews im Nachgang zur EM gezeigt: Die Clubs spüren in Bezug auf den Frauenfussball bereits einen Effekt – wenn auch nicht den grossen Boom.
«Der Wille zum Austausch mit SRF ist gross.»
Was habt ihr als Leitungsteam des Publikumsrats aus diesem Dialogfenster gelernt?
Wir haben gespürt, wie gross das Bedürfnis des Publikums ist, sich direkt mit den SRF-Programmschaffenden auszutauschen. Mit unserem Resonanzraum und den Dialogfenstern ermöglichen wir diesen direkten Kontakt für die breite Bevölkerung – ohne grosses Vorwissen, mit minimalen Bedingungen. Wir fanden für jede Erhebung und jede Fragestellung genügend Menschen, die über das SRF-Angebot sprechen wollten. Die Suche war zwar jeweils aufwendig und komplex, aber die Aufgabe nie unlösbar, eben weil der Wille zum Austausch gross ist. Und somit kann man sagen, dass wir die Publikumsresonanz bereits im ersten Dialogfenster sehr gut spürten. Das gibt uns die Motivation, den Aufwand auch für die nächsten Themen wieder mit Freude zu leisten.
Welche Dialogfenster gibt es im kommenden Jahr?
Wir sind tatsächlich bereits mitten in der Vorbereitung der nächsten Dialogfenster. Ein Thema, das wir dabei berücksichtigen möchten, ist die Bedeutung der Medien in einer postmigrantischen Gesellschaft, wie dies die Schweiz heute zweifellos ist. Aktuell sind wir daran, die dabei relevanten Fragen zu formulieren, mit dem Ziel, Ende diesen Jahres eine erste Umfrage zu lancieren.
Näher dran mit dem Mitgliedermagazin
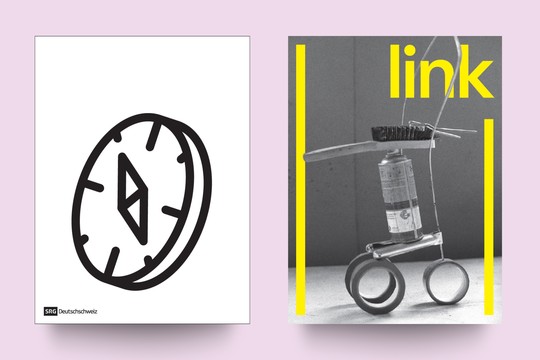
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden