Bettina Hamilton-Irvine: «Man darf der Leserschaft durchaus auch etwas zumuten»

Das Online-Magazin «Republik» setzt auf Hintergründe und grosse Zusammenhänge statt auf schnelle News. Co-Chefredaktorin Bettina Hamilton-Irvine spricht im Interview über journalistische Werte, KI – und über Journalist:innen als Marke.
Zur Person
Zur Person
Bettina Hamilton-Irvine ist seit Mai 2018 bei der «Republik». Seit Januar 2023 ist sie Co-Chefredaktorin. Daneben unterrichtet sie Journalismus an der Universität Freiburg und am Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ in Luzern. Sie selbst hat an der Queensland University of Technology in Brisbane, Australien, Journalismus studiert und war danach fast zehn Jahre für CH Media tätig, zuletzt als Chefredaktorin der «Limmattaler Zeitung».
Bettina Hamilton-Irvine, was braucht es für qualitativ hochstehenden Journalismus?
Es braucht Zeit, Sorgfalt und Ressourcen – für Recherchen, für eine sorgfältige Produktion, für einen Faktencheck, aber auch für das Hinterfragen von vermeintlichen Gewissheiten. Es ist sehr wichtig, dass man nicht etwa mit einer vorgefertigten These in die Recherche einsteigt und nur noch versucht, diese zu bestätigen. Deshalb darf es auch keinen Druck geben, irgendwelche Klickzielvorgaben erfüllen zu müssen. Eine Recherche muss auch scheitern dürfen. Zudem braucht es Unabhängigkeit, damit man nicht beeinflusst wird von irgendwelchen Interessensgruppen, der Politik, Werbekunden oder mächtigen Verlegern. Und es braucht eine gewisse Haltung.
Eine politische Haltung?
Nein, eine berufsethische Haltung: Die ganze Redaktion muss sich bewusst sein, dass man als vierte Gewalt eine Verantwortung trägt. Wir nennen das: Verantwortung für die Öffentlichkeit übernehmen. Heute wollen die Leser:innen nicht mehr einfach nur Informationen, sondern sie wollen jemanden, dem sie vertrauen können. Und dafür müssen sie auch wissen, wofür jemand steht. Nicht im Sinne einer politischen Meinung, sondern im Sinne einer Haltung gegenüber der Welt und der Menschen. Bei der «Republik» erkennt man diese zumindest teilweise an der Wahl unserer Kernthemen: Dazu gehören Demokratie und Rechtsstaat, aber auch Menschenrechte, Klima, Gleichstellung oder Medien. Diese thematische Priorisierung zeigt, was uns wichtig ist, ohne dass wir eine bestimmte politische Meinung haben müssen.
«Wir ziehen eine Community an, die sich für unseren Inhalt und für das, wofür wir stehen, interessiert.»
Die «Republik» verzichtet auf Werbung und finanziert sich über Abonnements. Heisst das nicht einfach, dass sie von ihren Leser:innen abhängig ist – oder, wie Sie es nennen, ihren Verleger:innen?
Ja, klar, zumindest teilweise. Das ist aber nichts Schlechtes – wir sagen jeweils mit einem Augenzwinkern, dass unsere Kund:innen gleichzeitig unsere Chefs sind. Bei unseren publizistischen Entscheidungen müssen wir überlegen, ob diese für unsere Zielgruppe nützlich sind und ob wir unserem Anspruch gerecht werden, Verantwortung für die Öffentlichkeit zu übernehmen. Gleichzeitig richten wir nicht alles danach aus – sonst würden wir nur noch Journalismus machen, der in dieser Community möglichst mehrheitsfähig wäre. Wir aber machen sehr bewusst Journalismus, der manchmal nischig ist, der manchmal nicht die Mehrheit anspricht – aber dafür ist gelegentlich ein einziger Text für eine kleine Gruppe von Leuten ein ganzes Jahresabonnement wert, weil sie dieses Thema oder diese Perspektive sonst nirgends erhalten.
Ohne Werbegelder entstehen für Medien aber auch Anreize, zu «Weltanschauungsbestätigern» zu werden, wie Hannes Grassegger es im Interview mit «LINK» formulierte. Dies, weil sie ihre eigene Leserschaft zufriedenstellen müssen, von der sie abhängig sind.
Ich verstehe diesen Punkt, glaube aber, es ist andersrum: Wir haben nicht eine Community und sorgen dann nur noch dafür, dass wir sie glücklich machen. Sondern wir ziehen eine Community an, die sich für unseren Inhalt und für das, wofür wir stehen, interessiert. Dass bei einem mitgliederfinanzierten Medium eine gewisse Gefahr einer Blasenbildung besteht, ist uns bewusst. Das ist an und für sich aber kein Problem, solange man sich immer wieder kritisch hinterfragt, seine Themensetzung immer wieder überdenkt, nicht bequem wird und sich weiterhin traut, seine Leserschaft herauszufordern. Als Redaktion reflektieren wir ständig, wie und welche Themen wir setzen. Und wir publizieren gelegentlich auch bewusst Beiträge, mit denen wir unserer Community etwas zumuten – etwa, indem wir sie mit einem unbequemen Standpunkt konfrontieren.
Zum Beispiel?
Wir verorten uns bewusst nicht politisch, werden aber als tendenziell linksliberal wahrgenommen, was sicher viel mit unseren Kernthemen zu tun hat. Auch wenn wir nicht wissen, wer in unserer Leserschaft in welcher Partei ist, so spürt man ihre politische Haltung teilweise aus den Kommentaren heraus. Schreiben wir zum Beispiel etwas Kritisches über die Grünen, dann ärgert das einen Teil unserer Verleger:innen. Für solche Geschichten wurden wir auch schon hart kritisiert – zuletzt beispielsweise, als wir ein kritisches Porträt über die linke Präsidentin Mexikos publizierten. Aber mir ist wichtig, dass wir auch linke Parteien, Gewerkschaften oder Standpunkte kritisieren können.
Was erwarten die Leser:innen von der «Republik»?
Bei gut 29 000 Verleger:innen ist das Natürlich schwierig zu sagen. Sie sind sehr heterogen, und ihre Erwartungen sind sehr vielfältig. Grundsätzlich aber ist das sicher eine Perspektive, die über das Tagesaktuelle hinausgeht, also weniger newsfokussierte Beiträge, und mehr solche, die hintergründig sind, Denkanstösse geben und grössere Zusammenhänge verständlich machen. Ein sehr schönes Kompliment, das wir immer wieder hören: «Ich habe jetzt schon so viel über dieses Thema gelesen, aber erst durch euren Beitrag habe ich es wirklich verstanden.» Der Versuch, Sinn aus dem zu machen, was in der Welt passiert, ist einer der Gründe, warum viele Menschen zu uns kommen. Und einige suchen auch eine Community.
Woran stellen Sie dies fest?
Dass sie einen Austausch mit anderen suchen, merken wir in den Kommentarspalten, wo unsere Journalist:innen direkt mit den Leser:innen diskutieren – auf sehr hohem Niveau. Dort entstehen manchmal ganz neue Ebenen, weil Leser:innen eigene Perspektiven einbringen und Beiträge von uns mit eigenen Erfahrungen ergänzen. Das ist einzigartig in der Schweiz. Auch interessiert viele, wie wir als Redaktion vorgegangen sind. Wenn unsere Journalist:innen erklären, was sie bedacht haben, warum sie sich für oder gegen etwas entschieden haben, dann gibt das einen zusätzlichen Mehrwert. Nicht zuletzt suchen gewisse Menschen bei uns einen Ort, an dem sie sich inspirieren lassen können, Lösungen finden oder sich manchmal auch ein bisschen trösten lassen, wenn einen die Welt gerade überfordert.
Sollten Journalist:innen präsenter sein und die Medienmarke mittragen?
Wir erwarten bei uns, dass sie in unserem Format «Dialog» eine gewisse Präsenz zeigen und soweit möglich auf Fragen, Inputs und Kritik reagieren. Denn dieser Austausch mit unserer Leserschaft ist ein Alleinstellungsmerkmal der «Republik». Ganz grundsätzlich fände ich es für die Schweizer Medienlandschaft aber schön, wenn die Medienschaffenden selbst präsenter wären. Gerade im schnellen Newsjournalismus ist ja eher das Gegenteil der Fall: Es werden zum Teil schon ganze Texte mit künstlicher Intelligenz generiert oder zumindest von KI unterstützt geschrieben, was das Ganze sehr oberflächlich und unpersönlich macht – und manchmal schlicht auch falsch. Für den Qualitätsjournalismus ist es eine Chance, sich auf der Gegenseite zu positionieren als ein Medium, das auf Menschen setzt, auf Journalist:innen, die als Persönlichkeiten greifbar sind. Wir merken, dass hier ein Bedürfnis besteht.
«Der Servicepublic- Auftrag der SRG ist essenziell, heute mehr denn je»
Welche Rollen spielen der Service public und private Medien?
Es braucht unbedingt beides, denn eine vielfältige Medienlandschaft ist zentral für die Demokratie und dafür, dass die Menschen sich eine informierte Meinung bilden können – doch beides ist derzeit in Gefahr. Ich betrachte mit grosser Sorge, wie öffentliche Medien auf der ganzen Welt unter Druck geraten. In der Schweiz sehe ich Kräfte hinter der Halbierungsinitiative, denen es generell um eine Destabilisierung der öffentlichen Medien geht, wenn nicht sogar mittelfristig um deren Zerstörung. Das hätte verheerende Folgen für die Demokratie und die Medienlandschaft in der Schweiz. Der Servicepublic- Auftrag der SRG ist essenziell, heute mehr denn je: Gerade jetzt, wo immer mehr Medien verschwinden, zusammengelegt oder ausgehöhlt werden, braucht die Bevölkerung einen Ort, wo sie sich informieren kann, um beispielsweise politische Entscheidungen zu fällen. Und wir brauchen ein Mediensystem, das auch Regionales und Lokales abdeckt, damit es nicht zu Newswüsten kommt wie in den USA.
Worin unterscheidet sich die Aufgabe der SRG und diejenige der Privatmedien?
Als «Republik» können wir sehr selektiv entscheiden, worauf wir fokussieren, weil wir in der Berichterstattung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit haben. So ergänzen sich private Medien gut mit einer SRG: Die SRG bereitet sozusagen den Boden mit einer Grundversorgung an Information, während sich die Bevölkerung bei spezialisierten Medien wie uns vertiefter über gewisse Themen informieren und möglicherweise auch noch andere Perspektiven finden kann. Wir können natürlich auch eine viel klarere Haltung einnehmen als die SRG, der vor allem von rechts schnell vorgeworfen wird, sie sei einseitig.
Sehen Sie darin die Zukunft des Journalismus – in längeren, tiefgehenden Artikeln?
In der Schweizer Medienlandschaft ist ja eher eine umgekehrte Tendenz feststellbar: Alles wird kürzer und schneller, es bleibt kaum Zeit für Recherchen … Ich würde nicht sagen, dass dies die Zukunft für alle ist. Medien müssen eine Nische für sich finden und ein Produkt anbieten können, das einen Mehrwert bietet und das man im Idealfall sonst nirgends erhält. Das müssen nicht unbedingt bei allen lange Artikel und investigative Recherchen sein. Aber es muss etwas sein, was den Leser:innen einen Grund gibt, zu einem zu kommen – und im Idealfall dafür zu zahlen. Wir haben unseren Weg gefunden. Aber wir haben auch einiges ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, wir sind stabil, unsere Leserschaft ist seit gut einem Jahr leicht wachsend. Interessanterweise kommen immer wieder Menschen zu uns, die sagen, sie hätten die Tageszeitung abbestellt. Wir profitieren wohl davon, dass gewisse grosse Medienhäuser nicht mehr in den Journalismus investieren. Aber ich würde mir nicht anmassen, zu sagen, dass unser Weg der einzig richtige ist. Es gibt in der Schweiz auch keinen Platz für zehn «Republiken».
«Es braucht ein Umfeld, in dem die Wichtigkeit von Journalismus als vierte Gewalt verstanden wird»
Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit qualitativ hochstehender Journalismus auch in Zukunft möglich ist?
Es braucht ein Umfeld, in dem die Wichtigkeit von Journalismus als vierte Gewalt verstanden wird. Es braucht ein Medienverständnis, das bereits in der Schule gelehrt wird. Es braucht ein Verständnis in der Politik dafür, dass kritischer Journalismus für eine liberale Demokratie unabdingbar ist. Und es braucht einen Konsens in der Gesellschaft, dass unabhängiger Journalismus wertvoll ist – und deshalb auch etwas kostet.
Näher dran mit dem Mitgliedermagazin
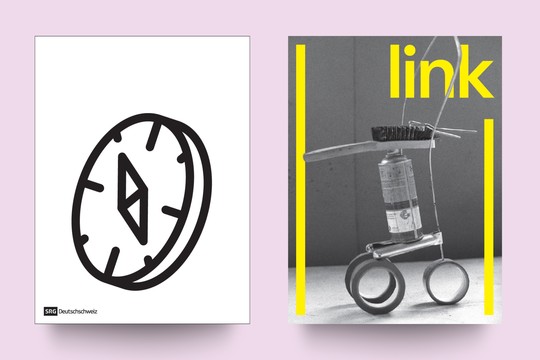
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden

