Fake News auf der Spur
Sind die spektakulären Videos auf Social Media auch echt? Wo wird mit Desinformation und Fake News manipuliert? Das SRF Netzwerk Faktencheck ist im Einsatz gegen die global zunehmenden Falschinformationen. So funktioniert das hauseigene Prüfsystem.
Die SRF-Mitarbeitenden haben mit dem SRF Netzwerk Faktencheck eine Anlaufstelle, um Informationen auf Wahrheitsgehalt und Inhalte auf Echtheit überprüfen zu lassen. Insgesamt 15 Kolleginnen und Kollegen engagieren sich neben ihrer alltäglichen Arbeit in verschiedenen Abteilungen bei SRF. Auf Anfrage recherchieren sie Fakten und zusätzliche Quellen und verifizieren audiovisuelle Inhalte.
Um welche Art von Inhalten geht es dabei?
Fake News – absichtlich verbreitete, irreführende oder falsche Informationen – treten in verschiedensten Formen auf. Dabei handelt es sich um Artikel, Bilder, Videos oder Social- Media-Posts, die schwer von journalistischen Nachrichten zu unterscheiden sind. Oft geht es beim Faktencheck um eine möglichst schnelle Verifizierung von Videos oder Bildern, die im Internet auftauchen – insbesondere in den sozialen Medien.
Wie funktioniert ein Faktencheck?
Um zu prüfen, ob Informationen oder Inhalte echt sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Grundregel beim Faktencheck lautet: Es braucht immer eine zweite, unabhängige Quelle – ausser die Information stammt von einem vertrauenswürdigen Absender. Für die Prüfung von Videos oder Bildern nutzt das SRF Netzwerk Faktencheck verschiedene Werkzeuge, etwa Open-Source-Tools, die frei im Internet verfügbar sind. SRF nutzt also vielfach Methoden, die auch Privatpersonen anwenden könnten: beispielsweise die Bilder-Rückwärtssuche von Google oder Geolokalisierung mithilfe frei zugänglicher Online-Karten.
Als Beispiel: Ein Video soll angeblich aus einer Stadt im Land X stammen. Beim Faktencheck wird nun überprüft, ob die Aufnahmen wirklich am angegebenen Ort entstanden sind oder nicht. Dazu werden gut sichtbare, auffällige Orientierungspunkte wie Strassenschilder oder markante Gebäude identifiziert und mithilfe von beispielsweise Google Street View gegengeprüft. Auch automatisch generierte, technische Metadaten werden gecheckt, etwa geografische Koordinaten, die im Hintergrund mit der Aufnahme verknüpft sind. Eine häufige Form von Desinformation ist nämlich, dass echte Inhalte in einen neuen Kontext gesetzt werden und somit eine neue Bedeutung erhalten. Das internationale Recherchenetzwerk Bellingcat bietet hierzu eine ganze Sammlung von Webtools an, kategorisiert nach dem jeweiligen Einsatzbereich.
Wann ist ein Faktencheck abgeschlossen?
Trotz aller Tools ist eine vollständige Verifizierung oft schwierig. Insbesondere, wenn die Zeit drängt. Deshalb arbeitet das SRF Netzwerk Faktencheck nach dem Prinzip der Falsifizierung: Welche Aspekte sprechen dafür, dass etwas korrekt ist, welche dagegen? Überwiegen kritische Aspekte, wird der Redaktion empfohlen, den Inhalt nicht zu verwenden oder darauf hinzuweisen, dass die Echtheit des verwendeten Inhalts nicht verifiziert werden konnte.
Muss SRF sämtliche Informationen checken?
Laut den Publizistischen Leitlinien von SRF sollen keine Inhalte publiziert werden, die falsch sind – oder von denen man hätte wissen können, dass sie nicht stimmen. Die Redaktorinnen und Redaktoren können viele Inhalte eigenständig prüfen, insbesondere wenn diese aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Die Wichtigkeit von Faktenchecks nimmt aufgrund des rasanten Fortschritts von künstlicher Intelligenz (KI) aktuell stark zu – eine Entwicklung, die in den kommenden Jahren weitergehen wird.
Was sind die grössten Herausforderungen für das SRF Netzwerk Faktencheck?
Zeitdruck und kurze Fristen bis zur Publikation sind häufig die grösste Schwierigkeit. Auch die Zunahme von KI-generierten, immer realistischer wirkenden Inhalten und Deep Fakes – Videos, in denen Mimik, Gestik und Stimme einer Person nachgestellt werden – stellen Faktencheckerinnen und Faktenchecker vor immer grössere Herausforderungen.
Näher dran mit dem Mitgliedermagazin
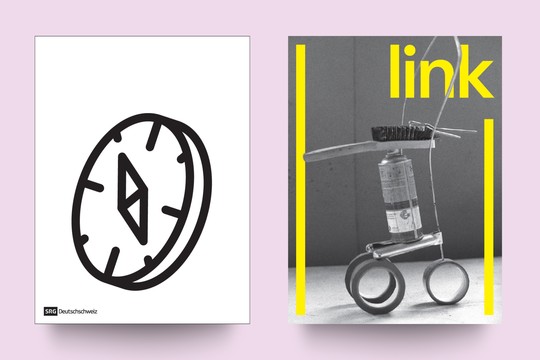
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden

