Können wir Medien? Das sagt die Wissenschaft

Es wird immer wichtiger, Medien und ihre Inhalte kritisch, reflektiert und verantwortungsvoll nutzen, verstehen, bewerten und auch selbst gestalten zu können. Doch wie gut ist unsere Medienkompetenz eigentlich? Antworten auf drei zentrale Fragen von Medienwissenschaftlerin Fiona Fehlmann.
Zur Person
Zur Person
Fiona Fehlmann ist Dozentin und Forscherin am Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW und ist Vorsitzende der Bildungskommission der SRG ZH SH.
Wie gut können wir Werbung von Journalismus unterscheiden?
Für viele Menschen ist es nicht einfach, Werbung und Journalismus zu unterscheiden – vor allem angesichts der wachsenden Verbreitung von gesponserten Inhalten auf verschiedenen Onlineplattformen. Insbesondere gilt das für bezahlte Werbeinhalte, die sich in Form und Stil nahtlos in redaktionelle Umfelder einfügen. Solche Native Ads müssen deshalb aus Sicht des Schweizer Presserats «optisch/akustisch eindeutig als solche erkennbar sein» und als Werbung deklariert werden.
Wie eine Studie des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW zeigt, waren 2021 die Formen der Kennzeichnung je nach Schweizer Medienhaus sehr unterschiedlich. Im Rahmen derselben Studie konnte anhand eines Online-Experiments mit 1800 Teilnehmenden gezeigt werden, dass gut ein Drittel die Kennzeichnung eines Beitrags als Native Ad nicht erkennt. Wird diese erkannt, dann tendenziell erst, wenn der Beitrag schon gelesen wurde.
Wie gut erkennen wir Fake News?
Die Fähigkeit, absichtlich verbreitete Falschnachrichten, also Desinformationen, zu erkennen, variiert je nach Person stark und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine ausgeprägte Medienkompetenz und hohes Vertrauen in journalistische Medien führen tendenziell dazu, dass Desinformationen besser erkannt werden. Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) hat im Jahr 2021 Schweizerinnen und Schweizer unter anderem dazu befragt, wie kompetent sie sich beim Erkennen von Desinformationen einschätzen. Hier zeigt sich: Die Befragten fühlen sich hierzulande beim Erkennen von Falschinformationen relativ kompetent (Mittelwert 3,1 auf einer Skala von 1 bis 5). Die Selbsteinschätzung von Männern in Bezug auf ihre Kompetenz war signifikant höher als die von Frauen, und jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren schätzten sich als kompetenter ein als ältere Personen.
Im Rahmen einer OECD-Studie von 2024, die über 21 Länder hinweg verglichen hat, wie gut die Befragten der Länder Fake News erkennen, zeigte sich aber: Die 1531 befragten Schweizerinnen und Schweizer erkannten lediglich in 55 Prozent der Fälle Desinformationen als falsch und landeten damit auf dem drittletzten Platz.
Wie gross ist das Vertrauen in die Medien in der Schweiz?
Das Vertrauen in Journalistinnen und Journalisten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das fög untersucht jährlich das Vertrauen in Nachrichtenmedien in der Schweiz. Diese Daten zeigen: Je nach Alter, Bildungshintergrund, politischer Orientierung sowie Sprachregion variiert das Vertrauen stark. In der französischsprachigen Schweiz ist es mit 38,7 Prozent geringer als in der deutschsprachigen Schweiz (42,2 Prozent). Und: Jüngere Personen mit einem eher niedrigen Bildungsniveau, die sich eher an den politischen Rändern verorten, haben ein geringeres Vertrauen in Medien als Menschen ab 35 Jahren mit höherer Bildung und einer politischen Orientierung Richtung Mitte.
Gesamt betrachtet zeigt sich: Etwas mehr als zwei Fünftel (41,2.Prozent) der Befragten stimmen eher oder völlig der Aussage zu, dass sie Nachrichtenmedien vertrauen. Rund ein Viertel (24,4.Prozent) vertraut diesen kaum oder gar nicht, und fast ein Drittel (31,4.Prozent) zeigt sich unentschlossen. Mit diesem Ergebnis liegt die Schweiz im europäischen Vergleich bezüglich Medienvertrauen auf Rang 10 von insgesamt 24 Ländern.
Näher dran mit dem Mitgliedermagazin
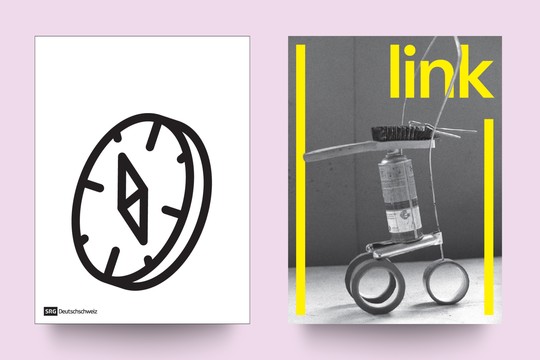
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden

