Vielfalt sichtbar machen
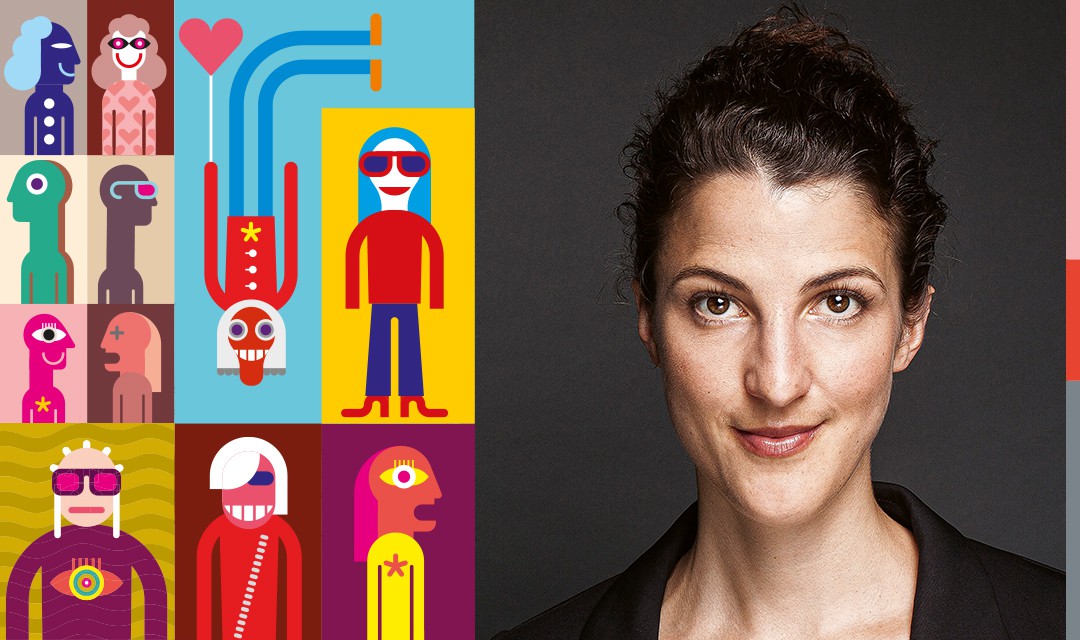
Der Begriff Diversität ist omnipräsent. Doch was heisst das für die Gesellschaft? Und worauf müssen Unternehmen und Organisationen achten? Antworten von der Sozialwissenschaftlerin Christine Lang.
Christine Lang, durch die Globalisierung werden Gesellschaften immer vielfältiger und durchmischter, eine starke Individualisierung findet statt – wie hängt das mit Diversität zusammen?
Wir müssen unterscheiden zwischen Individualisierung und wachsender Diversität. Eine zunehmende Individualisierung wird bereits seit den 1960er-Jahren beobachtet. Durch steigende Einkommen, höhere Bildungsniveaus und grössere Mobilität fand eine Ablösung von traditionellen Lebensformen statt, die etwa durch Religion, Familie oder soziale Klasse geprägt waren. Werte wie Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung wurden wichtiger. Diversität nimmt zu, einerseits durch Migration, andererseits aber auch, weil mehr auf die Bedeutung unterschiedlicher sozialer Kategorien geschaut wird, wie Ethnizität, Geschlecht, sexuelle Identität oder Behinderung. Es wird stärker wahrgenommen, wie diese die Erfahrungen und Identitäten prägen und Auswirkungen auf soziale Ungleichheit haben. Die Diversität an sich ist somit nicht unbedingt neu, nur rückt sie jetzt mehr in den Vordergrund.
Was heisst das für die Gesellschaft?
Fragen von gesellschaftlicher Teilhabe und Anerkennung werden wichtiger. Das zeigt sich etwa in politischen Forderungen nach mehr Partizipation, Repräsentation und Abbau von Diskriminierungen von Personengruppen, die bis jetzt in vielen gesellschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert oder gar unsichtbar waren. Die gesellschaftliche Ordnung wird neu diskutiert.
Man kann Eltern unterschiedlicher ethnischer Herkunft haben, sich aber trotzdem zu keiner der beiden zugehörig fühlen. So, wie auch Frauen Karriere in einem Ingenieurberuf machen können, ohne sich jemals diskriminiert zu fühlen.
Das stimmt, aber man kann den gesellschaftlichen Kontext nicht ausser Acht lassen. Man muss zwei Ebenen betrachten. Einerseits die individuelle Zugehörigkeit, also womit ich mich identifiziere. Andererseits die gesellschaftliche Relevanz dieser Kategorien – sprich, welche Rolle sie für andere spielen. Ich kann mich als Frau sehen, als Europäerin, Wissenschaftlerin usw. Doch gleichzeitig findet das immer auch in einem gesellschaftlichen Kontext statt.
Haben Sie Beispiele?
Für mich persönlich mag das Frau-Sein keine grosse Rolle spielen, aber in Bezug auf meinen Arbeitgeber vielleicht schon – etwa, wenn ich als Frau weniger verdiene oder weniger Karrierechancen habe als ein Mann. Ein anderes Beispiel: Eine in der Schweiz geborene Person mit ausländischen Eltern kann sich als Schweizerin oder Schweizer fühlen und sich nicht über die Herkunft der Eltern identifizieren. Aber wenn diese Person Diskriminierung erfährt, etwa wegen einer dunkleren Hautfarbe, dann ist diese Kategorie auf gesellschaftlicher Ebene dennoch relevant. Erst wenn es dort auch keine Rolle spielt, kann ich frei wählen, inwiefern mein Migrationshintergrund, mein Geschlecht oder meine Behinderung eine Bedeutung haben sollen.
«Die Repräsentation ist nötig, weil sie die Teilhabe symbolisiert.»
Christine Lang, Sozialwissenschaftlerin
Warum ist Diversität in der Gesellschaft überhaupt wichtig?
Es ist zunächst vielmehr eine Feststellung, dass es Diversität in der Gesellschaft gibt. Die Frage nach dem Nutzen von Diversität kann man zum Beispiel ökonomisch evaluieren: Bei Unternehmen wird oft von Diversity Management gesprochen – sprich, man will diversere Teams, weil man sich von diesen mehr Kreativität erhofft. Aber auch öffentliche Einrichtungen streben danach, vielfältiger zu werden, um so die Bürgerinnen und Bürger besser zu repräsentieren und anzusprechen.
Also ist es eher eine Frage der Repräsentation dieser Diversität?
Nicht nur. Bei Repräsentation geht es um Sichtbarkeit. Das bedeutet noch nicht, dass Zugangsbarrieren abgebaut sind. Können die 30 Prozent Frauen im Vorstand auch tatsächlich mitbestimmen, und ändert sich dadurch etwas an den Chancen für andere Frauen, in Führungspositionen zu gelangen? Die Repräsentation ist nötig, weil sie die Teilhabe symbolisiert. Besteht eine Zeitungsredaktion oder die öffentliche Verwaltung nur aus «weissen» Personen, dann wird dadurch symbolisiert, dass dort wenig Chancen zur Teilhabe bestehen. Dies ist auch bei politischen Fragen wichtig: Können Politikerinnen und Politiker Entscheidungen für die Bevölkerung treffen, wenn gewisse Kategorien im Parlament gar nicht repräsentiert sind?
Zumindest Bekenntnisse zur Vielfalt sind heute omnipräsent. Wie schätzen Sie das ein?
Erst einmal positiv. Wenn sich viele Organisationen und Unternehmen hinter dieses Bekenntnis stellen, kann das Auswirkungen auf andere haben. Die Vielfalt wird sichtbar und kann zu einem erstrebenswerten Ziel der Gesellschaft werden. Wenn es sich nur um eine Fahne handelt, die man raushängt, oder um ein buntes Bild, das man auf die Homepage setzt, kann die Vielfalt aber auch zu einem hohlen Versprechen werden. Die symbolische Darstellung der Diversität reicht nicht, sie muss auch in der Praxis umgesetzt werden. Deshalb muss man kritisch betrachten, was hinter solchen Bekenntnissen steckt.
Den Nutzen der Diversität zu messen, ist schwierig ...
Es geht nicht nur um ökonomischen Nutzen, sondern es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das Problem liegt an der fehlenden Diversität. Eine Förderung der Diversität geht aber nicht unbedingt einher mit einem Abbau von Zugangsbarrieren. Zu zeigen, dass man eine vielfältige Organisation ist, indem man mehr Frauen oder Personen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen setzt, reicht nicht. Man muss schauen, was überhaupt die Gründe sind, dass sie so wenig in Führungspositionen sind – und somit den Rekrutierungsprozess ändern.
Was halten Sie von Quoten?
Das ist ein heikles, sehr umstrittenes Thema. Es gibt auch Nachteile von Quoten, etwa, wenn Personen nur noch eingestellt werden wegen der Kategorie, zu welcher sie gehören – und nicht wegen ihrer Qualifikation. Auch ist es bei einigen Kategorien schwierig zu sagen, wer dazugehört. Repräsentiere ich als Deutsche in der Schweiz eine Person mit Migrationshintergrund? Das ist sicher nicht im Sinne der Einführung der Quote, da ich nicht zu einer unterrepräsentierten Kategorie gehöre. Quoten sind deshalb viel eher eine Massnahme, um Veränderungsdruck auf die Praxis aufzubauen und regelmässig Entwicklungen zu kontrollieren, wenn andere Massnahmen zu nichts geführt haben. Ich sehe sie quasi als letzte Möglichkeit.
Wie kann man Zugangsbarrieren sonst abbauen?
Zuerst braucht es eine ehrliche Bestandsaufnahme der Gründe. Woran liegt es, dass so wenige Frauen, Behinderte, Menschen mit Migrationshintergrund usw. in Zeitungsredaktionen oder in Leitungspositionen sitzen? Wie sehen die Rekrutierungsprozesse aus? Man macht es sich zu einfach, wenn man zum Beispiel sagt, unter den Absolventinnen und Absolventen von Journalismusschulen gebe es nur wenige Personen mit Migrationshintergrund. Da müsste man sich fragen, wo denn die Journalismusschulen ihre Studierenden rekrutieren. Es geht also nicht nur um Prozesse, die die eigene Organisation betreffen, sondern um solche, die oft einen ganzen Rattenschwanz mit sich ziehen. Wichtig ist auch die Arbeitskultur: Wo gibt es allenfalls Diskriminierung? Es hilft nicht, wenn man Frauen in Vorstände einberuft, die dann aber wieder ausscheiden und sich verabschieden, weil sie keine Unterstützung haben oder Diskriminierung erfahren. Nicht zuletzt sollte man sich auch Fragen zu seinem Angebot stellen: Welche Zielgruppen spreche ich an, wen erreiche ich? Bei Medien kann es zum Beispiel darum gehen, was für Inhalte, welche Geschichten wir abbilden, welche Erfahrungen wir sichtbar machen – und welche unsichtbar bleiben.
Wo liegt die grösste Herausforderung?
Der Abbau von Zugangsbarrieren ist ein langer, aufwendiger und unbequemer Prozess, der nicht ohne Konflikte realisierbar ist. Denn es bedeutet, dass man sich von bewährten, geschätzten Routinen verabschieden muss und gewisse Menschen Macht verlieren, die bisher unangefochten waren.
Muss man befürchten, dass man als «alter, weisser Mann» nichts mehr zu sagen hat?
Ich glaube nicht, dass eine Gefahr der Verdrängung besteht. Zwar sind Veränderungsprozesse nicht möglich, ohne dass Menschen in Machtpositionen einen Teil ihrer Macht abgeben. Aber zu sagen, man dürfe nun gar nichts mehr sagen, ist übertrieben und kann dazu führen, dass der ganze Prozess delegitimiert wird. Es geht ja nicht darum, dass «alte, weisse Männer» nichts mehr sagen können, sondern dass auch andere etwas zu sagen haben.
Die Forschung zeigt eine Diskrepanz zwischen Strategie und Praxis. Was ist nötig, damit so ein Strukturwandel tatsächlich klappt?
Es braucht klare Pläne mit klaren Massnahmen, die mit Zielen verknüpft und welche überprüfbar sind. Auch die Unterstützung der Leitungsebene ist grundlegend, ohne die läuft letztendlich wenig. Zudem braucht es zuständige Personen, die den Prozess begleiten und dafür aber auch mit Ressourcen und Entscheidungsmacht ausgestattet sein müssen. Ausserdem benötigt es ein kollektives Bewusstsein dafür, dass diese Prozesse wichtig sind und nicht von oben hinab diktiert werden. Dazu gibt es viele Schulungen, Programme oder Workshops, etwa zu Anti-Diskriminierung und zur Sensibilisierung bezüglich Darstellungen, die unterschwellig stereotype Bilder transportieren.
Nicht nur die Repräsentation, auch das Verlangen nach Teilhabe scheint durch die Digitalisierung immer lauter zu werden.
Das ist in der Tat eine spannende Entwicklung. Gerade über soziale Medien können Debatten viel klarer geführt werden, die über gewisse Bereiche und Länder hinausgehen. Die verschiedenen Hashtag-Bewegungen wie #MeToo oder #BlackLivesMatter haben zum Beispiel gezeigt, dass Erfahrungen, die geteilt werden, politische Konsequenzen haben können. So haben etwa Frauen realisiert, dass die Erfahrungen mit Sexismus, die sie vielleicht am Arbeitsplatz gemacht haben, nicht nur sie, sondern auch viele andere Frauen betreffen. Das Gleiche gilt bei Rassismus.
Gibt es eine Konkurrenz zwischen den Kategorien?
Per se nicht, denn sie sollten sich nicht ausschliessen, im Gegenteil. Wenn man die verschiedenen Kategorien gebündelt betrachtet, kann man spezifische Formen von Ungleichheiten sehen. Hier spricht man von Intersektionalität: Eine muslimische Frau, ein schwarzer Homosexueller, eine eingewanderte Person mit Behinderung oder eine alleinerziehende Mutter mit Kopftuch erfahren eine besondere Art der Diskriminierung. Das Zusammendenken verschiedener Kategorien kann also dazu führen, dass man verschiedene Formen von Ungleichheiten sieht. Zu einer Konkurrenz kann es allerdings dann kommen, wenn unter dem Label der Diversität einige Kategorien zwar mitgedacht werden, aber in der Politik und Praxis aus dem Blick geraten. Zum Beispiel wird in Frankreich unter dem Label Diversität viel über LGBTIQ oder Behinderung gesprochen, aber Probleme rassistischer Diskriminierung werden ausgeblendet.
Läuft man damit schlussendlich nicht Gefahr, eine Unterscheidung in «wir» und «die Anderen» festzuschreiben?
Jedes Kategoriendenken birgt diese Gefahr. Es kann dazu führen, dass Unterschiede verstärkt oder gar zementiert werden. Doch: Unterschiede gibt es durch Ungleichheiten. Wenn man eine Kategorie, zum Beispiel Ethnizität oder Migrationshintergrund, ausblendet und Personen nicht mehr danach unterscheidet, dann können sie dennoch weiterhin weniger Zugangschancen zu gesellschaftlichen Bereichen haben und die Ungleichheit bleibt bestehen. Um die Ungleichheit der Chancen zu beheben, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Unterschiede zu benennen.
Zur Person
Zur Person
Dr. Christine Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Ihre Forschung befasst sich unter anderem mit Diversität in Organisationen, lokaler Governance von Migration und Diversität, zivilgesellschaftlicher Partizipation sowie sozialer Mobilität in Migrationskontexten.



Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.